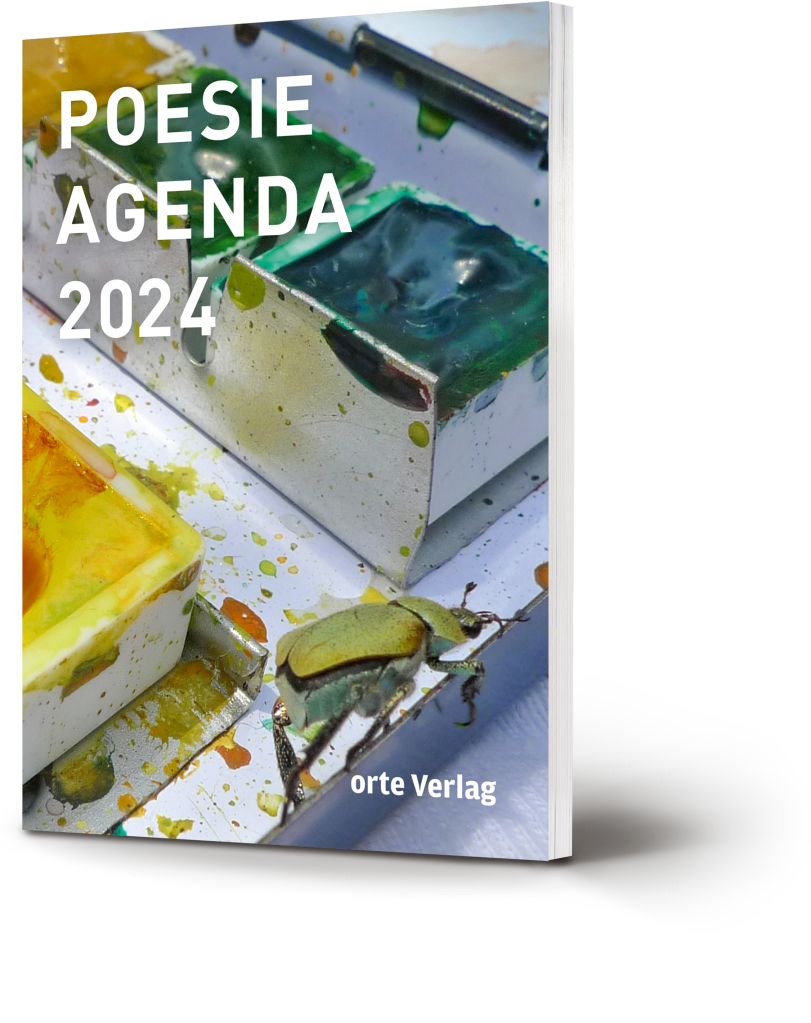Vor einiger Zeit habe ich im Fernsehen eine philosophische Sendung verfolgt. Gesprächspartner war ein Psychologenpaar. Ein Mann, eine Frau. Beide verwendeten konsequent eine gegenderte Sprache. Wenn sie beispielsweise von «Psychologen» sprachen, sagten sie «Psycholog-Innen». Das klingt in einem Gespräch nicht nur gekünstelt, sondern verwirrt auch. Der Sprecher ist gezwungen, sowas wie eine kleine Zäsur ins Wort einzubauen, während der Zuhörende sich jedes Mal fragt, wer denn jetzt genau gemeint ist. Die Psychologen als Gesamtheit oder nur der weibliche Teil davon? Oder vielleicht auch die vom dritten Geschlecht? Und weshalb spricht der Herr von sich als Psycholog-In? Und das Resultat dieser Fragen, die sich mir andauernd stellten: Die philosophischen Aussagen, die die beiden machten, gingen völlig an mir vorbei, dermassen irritierte mich diese Gendersprache.
Noch ein Beispiel: Ich hatte eine Diplomarbeit einer Lehrerin zu korrigieren. Im Text kamen ständig «Lehrerinnen und Lehrer» vor und als Abwechslung «Lehrkräfte» und «Lehrpersonen». Schon ab Seite drei der Arbeit hätte ich nicht übel Lust gehabt, den Lehrkräften von der PH, die solche Texte in Auftrag geben, einmal die Ohren langzuziehen. Sollten nicht gerade sie fähig sein, sprachlichen Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Noch viel schlimmer aber finde ich, dass in Diplomarbeiten eine solche Sprachregelung völlig undemokratisch angeordnet wird, ganz egal, was der Studierende davon hält.
Ihr seht schon und die Aufmerksamen unter euch, werden es schon längst in meinen Texten gesehen haben, von Binnen-I, Sternchen, Ersatzbegriffen und was dergleichen noch mehr in gegenderten (allein schon das ein Unwort) Texten herumgeistert, halte ich gar nichts. Mein Trost ist immerhin dies: Sie sind nichts als eine Mode und werden verschwinden, wie sie gekommen sind. Sprache operiert mit Vereinfachung. Was nicht benötigt wird und keinen Sinn macht, wird weggeschliffen, weggelassen. Aus rein praktischen Gründen.
Ich liebe unsere Sprache. Ich beschäftige mich damit, sie ist mein Werkzeug, ich sehe zu, wie sie sich verändert, wie neue Begriffe hinzukommen, alte verschwinden. Sprache betrachte ich als ein organisches Gewebe. Gendern kommt für mich einem Krebsgeschwür gleich. Aber ich schätze natürlich, wenn Menschen sich Gedanken um Gleichstellung und Gerechtigkeit machen. Ob der Sprachansatz etwas dazu beitragen kann, bezweifle ich sehr. Aber die Diskussion sollte offen bleiben. Und respektvoll.
Nun ist mir ein kleines Büchlein in die Hände gekommen, das sich mit dem Thema auseinandersetzt und mir in vielem aus dem Herzen spricht: Gendern wird nichts ändern von Alexander Glück. Glück vereint darin fünfzig „wertschätzende“ Argumente gegen die gewaltsame Deformierung unsere Sprache. Ich habe in dem Buch einige meiner Gedankengänge zum Thema wiedergefunden, aber auch zusätzliches gelernt. Wusstet ihr, dass es in England eine feministische Bewegung gibt, die weibliche Formen konsequent durch männliche ersetzt, also actress durch actor. Mit der Begründung, dass Gendern sexistisch sei?
Alexander Glück fächert seine 50 Gründe gegen das Gendern nach Themen auf: Sprachliche Gründe ebenso wie funktionale und politische, Gerechtigkeits- sowie gesellschaftliche Gründe. Manchmal hätte ich mir dennoch eine weiblichere Sicht auf die Dinge gewünscht. Zum Beispiel hier:
Gendersprache wird selektiv angewendet, sie ist auch deshalb ungerecht: Wörter wie «Mörder», «Einbrecher», «Terroristen» usw. werden kaum gegendert. (Ist das so?) Stattdessen werden rechte Demonstranten, obwohl zahlreich weiblich, als «Pimmel mit Ohren» maskulinisiert. (Ich finde «Pimmel mit Ohren» wunderbar bildhaft und witzig, würde aber doch vorsichtig mit dem Ausdruck sein. Es wäre klüger, die rechte Bewegung ernst zu nehmen, denn vor allem haben diese Pimmel und -innen sehr, sehr laute Stimmen. Aber danke, Herr Glück, für dieses köstliche Beispiel.)
Was ich mir noch gewünscht hätte in diesem Büchlein: eine besser lesbare Schrift. Argumente werden nicht eindrücklicher, wenn man sie in fetter Plakatschrift aus Papier bringt.
Dieses Büchlein enthält auch einen Aufruf, sich den wirklichen Problemen zuzuwenden. Hier wäre einzuwenden, dass genau dies sich nicht ohne Gleichstellung und Gerechtigkeit bewerkstelligen lässt. Wo der Autor aber Recht hat: Mit kleinlichen Grabenkämpfen kommen wir keinen Schritt vorwärts.
Autor: Alexander Glück
Titel: Gendern wird nichts ändern
Verlag: Der Apfel e. U., Wien, 2023
ISBN 978-3-85450-144-2, Euro 17.95
Kurz zusammengefasst: Der Autor hat 50 Gründe gegen das Gendern in der deutschen Sprache aufgelistet. Mitunter witzig.
Für wen: Wer bis jetzt sich aus dem Bauch heraus geweigert hat Binnen-I, Sternchen etc. einzusetzen, hat jetzt auch 50 gute Argumente dafür.